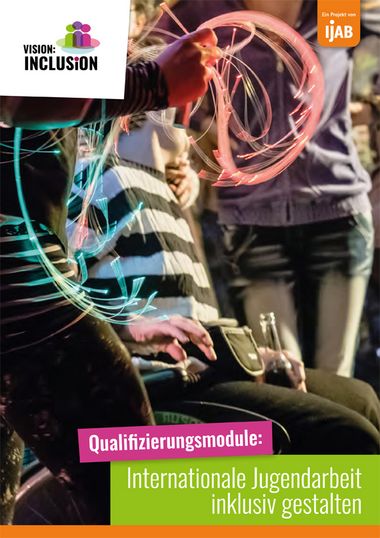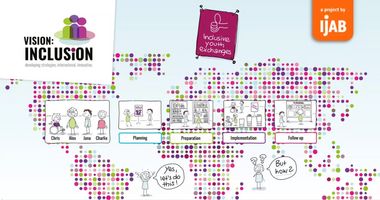Inklusion und Diversität
Die Begriffe Inklusion und Diversität werden oft in einem Atemzug genannt, unterscheiden sich aber in ihren Ansätzen. Beide Begriffe haben ihren Ursprung in Gleichberechtigungsbewegungen des letzten Jahrhunderts. Während Diversität mehr in Bewegungen genutzt wurde, die sich gegen Rassismus gegenüber schwarzen Menschen einsetzten, wurde Inklusion in Kontexten verwendet, in denen es um die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung ging. Inklusion wird mittlerweile meist breiter verstanden und z. B. auch auf Menschen bezogen, die sozial benachteiligt sind. Beide Konzepte stimmen darin überein, dass der Blick auf die individuellen Unterschiede von Menschen gerichtet wird. Die Unterschiede werden positiv bewertet und als Ressourcen betrachtet. Die Perspektive der Diversität ist eher beschreibend: „Differenzlinien“ werden festgestellt und dokumentiert, ohne dass dies eine Aufforderung zum Handeln implizieren würde. Mit dem Konzept der Inklusion ist die Vision einer inklusiven Gesellschaft verbunden, an der jede Person mit ihren Besonderheiten ohne große Anpassungsleistungen teilhaben kann.
Die gesetzliche Grundlage für ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen – also auch im non-formalen Bereich – gibt es in Deutschland seit Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009. Daraus ergibt sich für junge Menschen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung der Anspruch auf Teilhabe an den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe und der Internationalen Jugendarbeit. Viele Träger gestalten ihre Angebote bereits inklusiv, gerade bei der Beteiligung benachteiligter Jugendlicher wurden in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte erzielt. Trotzdem gibt es gerade mit Blick auf die Einbindung von Jugendlichen mit Behinderung in der Praxis immer noch große Herausforderungen, Unsicherheiten und Entwicklungsbedarf.